Dokumentation ist eigene rechtliche Absicherung
Aufgrund mehrerer rechtlicher Regelungen ist die Praxis gehalten, eine Behandlungsdokumentation zu führen. Diese fixiert die Inhalte der Behandlung sowie das Wesentliche zur Aufklärung. Im Fall einer Auseinandersetzung vor Gericht kann der Patientendokumentation eine entscheidende Bedeutung zukommen.
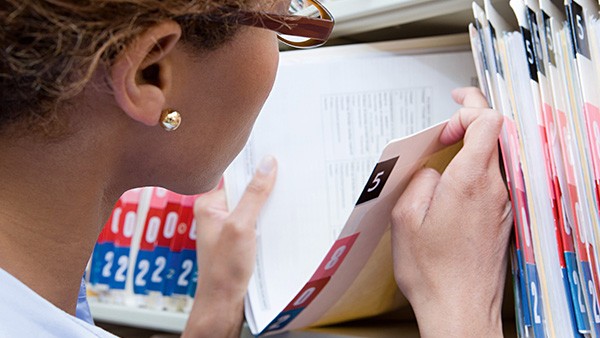
© XiXinXing/istockphoto
Grundsätzlich gehen die Gerichte zunächst einmal davon aus, dass die Dokumentation in Ordnung ist und damit auch davon, dass das, was dokumentiert wurde, auch gemacht wurde. „Grundsätzlich kann das Gericht einer formell und materiell ordnungsgemäßen Dokumentation, die … keinerlei Anhalt für Veränderungen/Verfälschung oder Widersprüchlichkeiten bietet, Glauben schenken.“ (OLG München, Urteil vom 15.07.2011, Az. 1 U 5092/10) Das gilt vor allen Dingen, wenn die Dokumentation detailliert, medizinisch plausibel und schlüssig ist und keinerlei Lücken oder Fehler erkennen lässt.
Zweifel an der Dokumentation
Möchte der Patient argumentieren, die Dokumentation sei nicht korrekt, muss er berechtigte Zweifel an der Richtigkeit darlegen. Ohne konkreten Anlass wird das Gericht nicht an der Dokumentation zweifeln. Ein Patient wird also mit der pauschalen Behauptung, die Dokumentation sei nicht richtig, gerade nicht durchkommen. Er ist insoweit nicht nur für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers in der Beweislast, sondern auch bezüglich der Behauptung, die Dokumentation sei nicht korrekt.
Ist eine Dokumentation äußerlich ordnungsgemäß, kann man selbst bei einer verzögerten Vorlage beim Gericht nicht ohne Weiteres davon ausgehen, sie sei manipuliert worden. Das gilt erst recht, wenn der Behandler eine plausible Begründung für die verspätete Vorlage geben kann (OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.03.2005, Az. 8 U 56/04).
Nach wie vor kursiert der weit verbreitete Irrtum, ein vom Patienten unterschriebener Ausklärungs- oder Einwilligungsbogen biete eine 100-prozentige Absicherung. Dies ist allein deswegen nicht so, weil zwingend eine mündliche Aufklärung durch den Behandler erfolgen muss und ein solches Gespräch niemals durch die Überreichung eines Bogens ersetzt werden kann; auch dann nicht, wenn der Patient unterschreibt, er habe den Bogen gelesen und verstanden.
Bogen vom Patienten unterzeichnen lassen
Selbstverständlich ist es dennoch sehr hilfreich, einen vom Patienten unterzeichneten Bogen zu haben. Dabei ist es sehr von Vorteil, wenn der Bogen erkennbar patientenbezogen ist. Dazu können handschriftliche Eintragungen sowie Skizzen und Notizen zu persönlichen Angaben des Patienten unterstützend hinzukommen.
Das OLG Düsseldorf führt in seinem Urteil vom 17.03.2005 (Az. 8 U 56/04) dazu aus: „Der Beklagte hat nachvollziehbar angegeben, dass und warum er eine konkrete Erinnerung an das Gespräch mit dem Kläger hat. Seine Darstellung wird durch die Eintragungen in dem vom Kläger unterzeichneten …-Bogen gestützt. Dass ein Aufklärungsgespräch überhaupt nicht stattgefunden hat und dieser Aufklärungsbogen dem Kläger – wie er behauptet – bereits vollständig ausgefüllt lediglich kommentarlos zur Unterschrift vorgelegt wurde, ist bereits deshalb nicht glaubhaft, weil der Bogen auf Seite 3 Angaben zu Vorerkrankungen und Medikamenten enthält, die nur vom Kläger selbst stammen können und die augenscheinlich mit einem anderen Stift eingetragen worden sind als die Angaben zum Inhalt des Aufklärungsgesprächs. Es ist auch nicht plausibel, dass der Kläger seine Unterschrift geleistet haben will, obwohl auf Seite 4 des Bogens nähere Angaben zu einem Aufklärungsgespräch enthalten sind, das nach seiner Darstellung gar nicht stattgefunden haben soll.“ Die Patientendokumentation ist also nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine eigene rechtliche Absicherung.
Die Expertin
Dr. Susanna Zentai
ist Medizinanwältin in der Kanzlei Dr. Zentai – Heckenbücker in Köln und als Beraterin sowie rechtliche Interessenvertreterin (Zahn-)Ärztlicher Berufsvereinigungen tätig.





